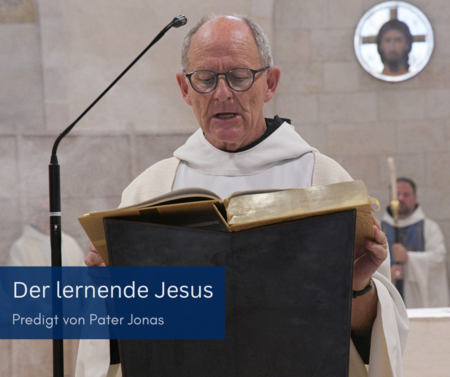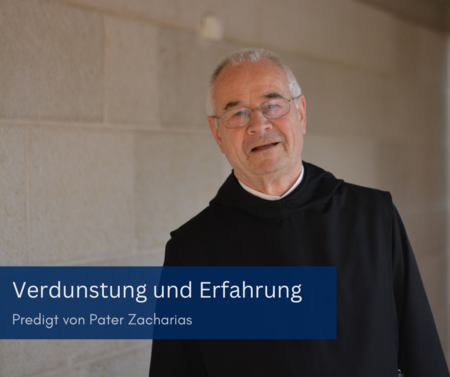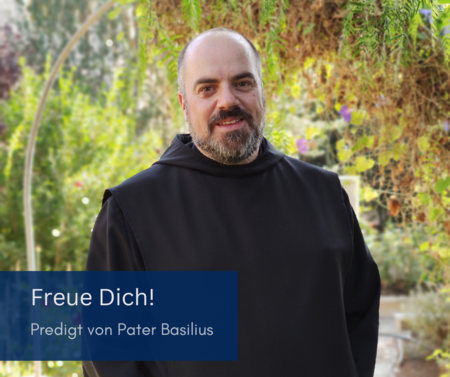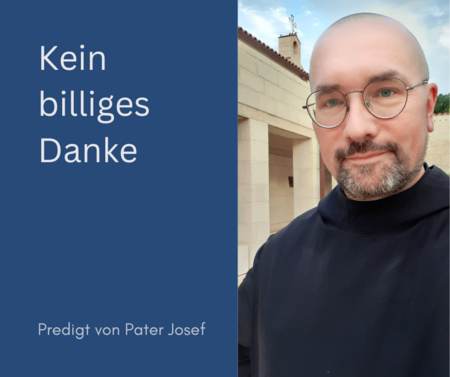angezeigt: 11 bis 20 von 388
388 Einträge wurden gefunden
Maßstab der Vergebung
17. September 2023
 Unsere heutige erste Lesung aus dem Alten Testament klingt, als wäre sie von einem christlichen Autor geschrieben, und doch wurde sie etwa zwei Jahrhunderte vor Christi Geburt verfasst. Der jüdische Autor, den die Tradition Jesus Sirach nennt, dessen Name eigentlich aber Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira ist, provoziert uns mit genau demselben Maßstab für Vergebung, den auch Jesus uns im Vaterunser lehrt. Mit Jesus Christus zusammen beten wir zu unserem himmlischen Vater: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". Im Weisheitsbuch von Jesus Sirach lesen wir: „Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben!“; und er stellt eine unbequeme Frage: „Ein Wesen aus Fleisch verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben?"
Unsere heutige erste Lesung aus dem Alten Testament klingt, als wäre sie von einem christlichen Autor geschrieben, und doch wurde sie etwa zwei Jahrhunderte vor Christi Geburt verfasst. Der jüdische Autor, den die Tradition Jesus Sirach nennt, dessen Name eigentlich aber Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira ist, provoziert uns mit genau demselben Maßstab für Vergebung, den auch Jesus uns im Vaterunser lehrt. Mit Jesus Christus zusammen beten wir zu unserem himmlischen Vater: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". Im Weisheitsbuch von Jesus Sirach lesen wir: „Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben!“; und er stellt eine unbequeme Frage: „Ein Wesen aus Fleisch verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben?"
Eine ähnliche Fragestellung finden wir auch im heutigen Evangelium. In dem Gleichnis fragt der Herr den Knecht, dem er gerade erst seine Schulden erlassen hatte: „Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?“ Diese Frage ist wie ein Echo auf die Worte der ersten Lesung: „Mit einem Menschen gleich ihm hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung?“ Sowohl Jesus Sirach als auch Jesus Christus widersprechen dem Mainstream, nämlich der weit verbreiteten Auffassung, es sei nur unser gutes Recht, eine Kränkung, eine Verletzung oder ein Unrecht zu verübeln; dass es daher eine Grenze für unser Verzeihen und unsere Versöhnungsbereitschaft gäbe, über die hinaus wir nicht so hohe Ansprüche an uns selbst stellen müssten. Unser Herr Jesus Christus stellt genau diese Grenze in Frage, wenn er sagt: „nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal“, solle man vergeben. Petrus hatte ihn gefragt, ob es reicht, wenn man einem Sünder siebenmal vergibt. Jesu Antwort ist eindeutig: Man solle gar nicht erst auf die Idee kommen, aufzurechnen, wie oft man dem anderen vergeben müsse. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht will deutlich machen, warum es diese Grenze nicht geben darf: Umsonst haben wir empfangen, umsonst sollen wir geben. Genauso wie mir vergeben wird, soll ich vergeben. Wenn wir das tun, entdecken wir, was Barmherzigkeit bedeutet.
Und was geschieht, wenn wir nicht verzeihen? Im Gleichnis heißt es: „In seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern.“ Und dann ist da dieser erschütternde Schlusssatz: „Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt.“ Wir brauchen nicht nur unermessliche Barmherzigkeit, sondern auch unermessliche Gnade. Nichts anderes als die maßlose Liebe Christi kann uns zu einer solchen Vergebung von Herzen bewegen. Allerdings wird diese aufrüttelnde Aufforderung zur unbegrenzten Vergebung schon mal gerne missverstanden: „Schwamm drüber!“; „Halb so wild!“; „Es tut ja keinem weh!“ sagen wir dann gerne. Doch christliche Vergebung erwächst nicht aus der Gleichgültigkeit gegenüber dem, was falsch ist. Sie entspringt vielmehr der Dankbarkeit und der Liebe: der manchmal fassungslosen Dankbarkeit gegenüber unserem himmlischen Vater, der unserer Gebrochenheit und unserer Schuld mit pochendem Herzen und offenen Armen entgegeneilt; und der geduldigen, scheinbar törichten Liebe gegenüber dem anderen, der uns Unrecht tut. Johannes Klimakos sagt es im im 7. Jahrhundert so: „Wenn du dich aufmachst, um vor den Herrn zu treten, sei dein Gewand gänzlich aus dem Stoff des Nichtnachtragens gewoben, andernfalls wird dir das Gebet nichts nutzen.“
---
Pater Josef und alle Brüder in Tabgha und in Jerusalem wünschen Euch einen gesegneten Sonntag!
Über
Alle Blogbeiträge von
Gegen das Graugraugrau
10. September 2023
 Liebe Schwestern und Brüder, man kann verschiedene, wichtige Impulse und Fragen aus unserem Tagesevangelium mitnehmen:
Liebe Schwestern und Brüder, man kann verschiedene, wichtige Impulse und Fragen aus unserem Tagesevangelium mitnehmen:
Zum Beispiel, dass es auch in der Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen, Sünde gibt. Christinnen und Christen sind keine Engel. Sie machen Fehler im Umgang untereinander, im Blick auf sich selbst, in ihrem Verhältnis zu Gott. – Dieser Blick in den eigenen Spiegel ist wichtig, ein erster notwendiger Schritt auf die Wahrheit und zum Heil hin. Jeden Tag.
Ein anderer Input in diesem Zusammenhang: Die Gemeinschaft lässt den, der da in den Spiegel schaut oder der eben nicht in den Spiegel schaut, nicht allein. Ein Grundelement christlicher Berufung und christlichen Lebens: Nicht Wegschauen, schon gar nicht Verurteilen. Hingehen, Dasein, Mitgehen. Beten miteinander und füreinander.
Ein Drittes: Keiner hat allein und für sich die Wahrheit. Das klingt ebenso banal, wie es sich andererseits erschreckend wenig oft im Umgang der Christenkinder untereinander ablesen lässt. Manche, die eigentlich der Wahrheit dienen wollen, scheinen doch in der noch größeren Versuchung zu stehen, ideologischen Konstrukten hinterherzulaufen. – Keiner allein, es braucht die zwei oder drei Zeugen!
Gerade für mich als Mönch, der ich auch die Einsamkeit suche, kann das eine Herausforderung sein. – Oder, positiv formuliert: Es liegt darin eine wirklich tägliche Chance zum Neuanfang. Auch Mönche sind beileibe keine Engel, machen Fehler, verrennen sich oder verstocken sich, werden betriebsblind und abgestumpft. Aber dafür leben wir gerade in Gemeinschaft: um einander zu helfen und zu stützen, um uns gegenseitig aus den verschiedenen Sackgassen des Lebens herauszuholen, nicht alleine zulassen. Jeden Tag neu im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des Vaters, im Wagnis der Führung durch den Heiligen Geist und im Namen Jesu, unseres Herrn und Bruders.
Dann bleibt das viel Zitierte „wo zwei oder drei“ nicht bei einer Wohlfühl-Floskel stecken, sondern kann zu einem echten Bauelement gelingenden christlichen Lebens werden für den Einzelnen und für die Gemeinschaft.
Ich möchte noch einen weiteren Blick auf dieses „zwei oder drei“ werfen. Denn ich glaube, dass es gerade für die Kirchengemeinschaft unserer Tage einen weiteren Input enthält: die Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit von Zwischentönen. Es geht nicht um eine gleichgültige Nivellierung oder um eine leichtfertige Relativierung eines Strebens nach Wahrheit. Es geht schlicht um das ehrliche Eingeständnis, dass es in unserem Leben als Menschen nicht nur Schwarz oder Weiß gibt. Das klingt banal. Und es wird sogar gefährlich, wenn man sich damit trösten möchte, sich selbstgenügsam irgendwo im Graugraugrau der Beliebigkeit einzunisten. Schon deshalb ist es wichtig, dass wir uns ehrlich dem Leben in der Gemeinschaft stellen. Allein deswegen sind Prozesse wie der Synodale Weg der Kirche in Deutschland oder die Weltsynode am Vatikan wertvoll – an dieser Stelle erst einmal wertfrei hinsichtlich Erwartungen und Ergebnissen.
Mir wurde das in einem völlig anderen und doch sehr naheliegenden Kontext in den vergangenen Wochen neu bewusst. Wir sind derzeit dabei, mit lokalen bildenden Künstlern, vor allem Israelis aber auch Palästinensern, eine Ausstellung unter der Überschrift „Glauben“ vorzubereiten, die Ende Oktober hier in der Dormitio und an weiteren Stellen auf dem Zionsberg Kunstwerke verschiedener Art zeigen wird. Daher hatte ich inzwischen mehrere Kirchenführungen und -besuche mit diesen Künstlerinnen und Künstlern. Sie wiesen mich immer wieder auf das spannende Farbenspiel unserer Deckenpartien hier in der Basilika hin: Rot und Blau und Gold bzw. Gelb. Die drei Grundfarben, aus denen sich fast alle weiteren Farben mischen lassen. – Wo zwei oder drei… Und dann gibt es all die anderen wunderbaren Stellen im Farbspektrum wie Violett oder Grün oder Orange, in sich nochmals schattiert und nuanciert.
Liebe Schwestern und Brüder, ich verstehe das Tagesevangelium als ein echtes Bauelement gelingenden christlichen Lebens für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Seine Farbspritzer möchte ich Ihnen und Euch in die neue Woche mitgeben! Mischen wir immer wieder etwas von den Dormitio-Gewölben in unser Leben: Vom Rot der Liebe, vom Rot der Hingabe, vom Rot des Feuers des Heiligen Geistes. Vom Blau der Vertrauens Mariens, vom Blau des Wassers der Fußwaschung, vom Blau der Nacht des Brotbrechens. Vom Goldgelb des Ostermorgens, vom Goldgelb der Heilung und Befreiung im Namen Christi, vom Goldgelb der Versöhnung mit Gott, mit uns selbst und untereinander. Amen.
---
Pater Basilius und alle Brüder in Jerusalem und in Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Unser Name ist Petrus
27. August 2023
 Es war das erste Mal, dass ein Papst vor dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf sprach; zum ersten Mal überhaupt, dass ein Papst die Stadt des großen Reformators Johannes Calvin betrat: vor über 50 Jahren, im Jahr 1969. Paul VI. rief dem versammelten Rat der Kirchen im damals noch üblichen Pluralis Majestatis entgegen: „Unser Name ist Petrus!“ Diese Worte, die aus heutiger Sicht von einem vielleicht überzogenen Sendungsbewusstsein des Bischofs von Rom zeugen, war damals, zu Beginn der ökumenischen Bewegung aus römischer Sicht lediglich die Darlegung des Selbstverständnisses Roms gegenüber den anderen christlichen Kirchen. Unmissverständlich und ganz offensichtlich klingt in diesen Worten der Satz aus dem Matthäus-Evangelium an, der im heutigen Evangelium hören ist, und der seit über 500 Jahren das Innere des Petersdoms in Rom in überdimensionalen Lettern schmückt. Jesus Christus selbst hatte ja den Fischer aus dem Dorf Bethsaida beauftragt: „Du bist Petrus, Felsenmann, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen.“
Es war das erste Mal, dass ein Papst vor dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf sprach; zum ersten Mal überhaupt, dass ein Papst die Stadt des großen Reformators Johannes Calvin betrat: vor über 50 Jahren, im Jahr 1969. Paul VI. rief dem versammelten Rat der Kirchen im damals noch üblichen Pluralis Majestatis entgegen: „Unser Name ist Petrus!“ Diese Worte, die aus heutiger Sicht von einem vielleicht überzogenen Sendungsbewusstsein des Bischofs von Rom zeugen, war damals, zu Beginn der ökumenischen Bewegung aus römischer Sicht lediglich die Darlegung des Selbstverständnisses Roms gegenüber den anderen christlichen Kirchen. Unmissverständlich und ganz offensichtlich klingt in diesen Worten der Satz aus dem Matthäus-Evangelium an, der im heutigen Evangelium hören ist, und der seit über 500 Jahren das Innere des Petersdoms in Rom in überdimensionalen Lettern schmückt. Jesus Christus selbst hatte ja den Fischer aus dem Dorf Bethsaida beauftragt: „Du bist Petrus, Felsenmann, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen.“
Doch diese Beauftragung des Petrus fällt nicht vom Himmel. Ihr geht ein deutliches Bekenntnis desselben, also des Petrus, voraus. Und zwar eines, das auf die Frage an alle Jünger, „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“, sprich, „Was glaubt ihr denn, wer ich bin, ihr, die ihr mir gefolgt seid?“, antwortet. Dem Petrus kommt schon durch seine Antwort, als Sprecher der Jünger, eine Art Führungsrolle zu, mit dem, vielleicht eher zaghaft und suchend als sicher formuliertem Bekenntnis: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“
Doch diese Haltung für andere zu antworten und dann die zukünftige Aufgabe des Petrus das Fundament zu bilden, auf dem die Verkündigung der anderen aufbauen kann, diese Funktion, die ihn vielleicht auch für den Moment vollkommen überfordert, was macht sie mit den anderen Jüngern? Natürlich kann sie zu einer herausfordernden Reibungsfläche werden. Sie könnte sogar für die anderen zu (mindestens) zwei, geradezu verhängnisvollen Haltungen führen: Zum einen könnte es da ein Zurücklehnen geben, das zu Desinteresse, ja zu einer Teilnahmslosigkeit führt, frei nach dem Motto: ‚Dann soll er mal machen, er, der sich mal wieder nach vorne drängt.‘ Auf der anderen Seite, könnte es zu einer Haltung der Eifersucht, des Nach-oben-Schielens kommen: ‚Warum denn eigentlich schon wieder Petrus? Warum denn nicht mal der Andreas, oder der Philippus? Warum eigentlich nicht ich?‘
Doch bevor sich hier jemand zurücklehnt oder sich voll Eifersucht verzehrt, wenn es um die Sache Gottes geht, um die Sache dessen, der ganz barmherzige Liebe ist, der beachtet nicht, dass dieses Wort des Petrus das Bekenntnis aller Jünger nur ein paar Kapitel zuvor in Erinnerung ruft, ja lediglich wiederholt. Angesichts des Seewandels Jesu und der Rettung des Petrus hatten alle Jünger im Boot bekannt: „Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du!“. Durch diese direkte Aufnahme der ‚allgemeinen‘ Jüngermeinung durch Petrus wird noch einmal unterstrichen, dass es nicht so sehr um ein persönliches Bekenntnis des Petrus, sondern vielmehr um ein nochmals neu aufgelegtes Bekenntnis der Jünger durch ihren Sprecher Petrus geht. Dieses Bekenntnis können alle die Jünger mitsprechen, die Jesus Christus gefolgt sind.
Und ein zweites: Zur Beauftragung des Petrus gehört seine gesamte herausfordernde Geschichte: Von der Angst auf dem See über das Bekenntnis bis hin zur Verleugnung. Gerade dieses Versagen des Petrus wird hier in der Nachbarschaft des Zions, in St. Peter in Gallicantu uns besonders anschaulich vor Augen geführt. Am Ende ist das glasklare Bekenntnis hoch im Norden des Landes, weit weg von Jerusalem, in Cäsarea Philippi, tatsächlich in weite Ferne gerückt und fast schon vergessen. Doch Jesus, der Petrus besser kennt, als er sich selbst, sieht in ihm, einen wirklichen Zeugen seiner Botschaft – gerade, weil Petrus sich selbst immer wieder damit auseinandersetzen muss! Petrus, ist der Kleingläubige, doch auch der Mutige, der Bekenner und doch der Verleugner. Spiegelt das nicht auch unser aller Leben wider? Höhen und Tiefen, Zweifel und felsenfestes Vertrauen? Wenn Petrus durch sein eigenes Leben bezeugen kann, wie Gott in Jesus seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe und seinem Verzeihen Ausdruck verliehen hat, geht das dann nicht auch uns an? Wir könnten dann auch, vorsichtig, tastend, doch glassklar mitsprechen: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“
Vielleicht hatte Paul VI. also doch recht: „Unser Name ist Petrus.“ In gewisser Weise sind wir alle sind (wie) Petrus und können beten:„Herr erwecke deine Kirche und fange bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an.“
---
Pater Simeon und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Der lernende Jesus
20. August 2023
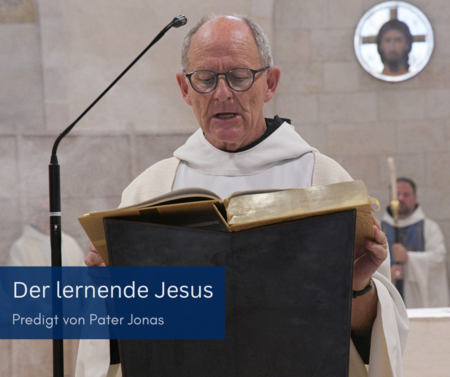 „Der lernende Jesus“ – das ist sozusagen die Überschrift, die für mich über dem heutigen Evangelium steht. Am Ende dieser Erzählung über Jesus, die wir heute hören, sagt der Messias und Gottes Sohn zu einer kananäischen Frau: „Dein Glaube ist groß“ – und er gelangt zu dieser Überzeugung durch Erkenntnis und Lernbereitschaft. Jesus hat von der Frau gelernt, die nicht locker ließ von ihrer Überzeugung, dass nur ER ihrer Tochter helfen kann. Sie konfrontiert Jesus mit der Aussage, dass das Heil, das er den Menschen bringt, ausreichend ist für die Berufenen wie auch für die Gottlosen, die sogenannten Heiden.
„Der lernende Jesus“ – das ist sozusagen die Überschrift, die für mich über dem heutigen Evangelium steht. Am Ende dieser Erzählung über Jesus, die wir heute hören, sagt der Messias und Gottes Sohn zu einer kananäischen Frau: „Dein Glaube ist groß“ – und er gelangt zu dieser Überzeugung durch Erkenntnis und Lernbereitschaft. Jesus hat von der Frau gelernt, die nicht locker ließ von ihrer Überzeugung, dass nur ER ihrer Tochter helfen kann. Sie konfrontiert Jesus mit der Aussage, dass das Heil, das er den Menschen bringt, ausreichend ist für die Berufenen wie auch für die Gottlosen, die sogenannten Heiden.
Wie lest Ihr, lesen Sie diese unglaubliche Geschichte jener kananäischen Frau? Ja, am Ende gibt es ein Happy-End; faszinierender ist aber die Ausgangssituation: Eine Frau, zudem eine Namenlose, wendet sich in höchster Not, in der Sorge um ihre psychisch kranke Tochter, an Jesus – und wird keineswegs gleich erhört. Vielmehr entwickelt sich ein dramatisches Gespräch, ein Rededuell mit verschiedenen Zeichenhandlungen, in dessen Verlauf erst die Wende zum Guten erkämpft wird.
„Er gab ihre keine Antwort“ – Jesus war wütend … die Bitte dieser Frau scheint Jesus zu ärgern. Warum? Dann demütigt er diese Frau. Warum verhält sich Jesus so? Ist sein Verhalten gerecht? Tut sie nicht, was alle Mütter tun würden für ihr Kind? Sie ist bereit, sich beschimpfen zu lassen, wenn nur ihrem Kind geholfen wird.
Wenn die ganze Geschichte mit all den unterschiedlichen Facetten gehört wird, erschließt sich, wie sehr sie Glauben im Prozess darstellt – ein Glaube, an dem es nur Beteiligte gibt: Jesus, die Frau und die Jünger. Matthäus spricht von einer kanaanäischen Frau, einer auf der anderen Seite der Grenze, einer Heidin, damit ist eine neue Situation eröffnet.
Die Pointe liegt gerade darin, dass Jesus es mit einer nichtjüdischen Frau zu tun bekommt. Jesu Verhalten, ihr erst nicht zu antworten und ihr dann ein abwehrendes, ja beleidigendes Wort entgegenzuhalten, zielt gar nicht gegen sie als Frau, sondern als Heidin. Es geht um die Sendung Jesu: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.“ Im Klartext heißt es: Für Dich bin ich nicht zuständig!
Daran schließt sich der bildhafte Vergleich mit dem Brot, das nicht den Kindern weggenommen werden darf, um es den Hunden zu geben, an. Und wieder erfährt die verfahrene Situation eine erstaunliche Wende durch die Reaktion der Frau. Sie nimmt das rüde Wort auf und führt es so weiter, dass sie bekommt, was sie braucht, „die Brotreste, die vom Tisch fallen“. Ohne die Sendung Jesu zu seinem Volk infrage zu stellen, gelingt es ihr, ihn zu öffnen für die anderen, die Nichtjuden, die Heiden, die ihn und sein Evangelium genauso brauchen.
Die Größe ihres Glaubens, den Jesu anerkennt und auf den hin er ihre Tochter heilt, erweist sich vor allem in diesem Lernprozess, in den sie Jesus und seine Jünger hineinverwickelt. Jesus erfährt an ihr, dass es auch außerhalb Israels Menschen gibt, die ihm unverbrüchlich vertrauen und ihn als den Messias bekennen. „Hab erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids“. Das ist nicht nur ein Hilferuf, es ist ein ganzes Glaubensbekenntnis, das Jesus entgegenschlägt.
Schauen wir nochmal auf Jesus. Er zeigt sich in dieser Perikope als von der Frau und ihrem Glauben Lernender. Er, der Lehrer ist zugleich Lernender, ganz Mensch, zu dem das Lernen gehört – eine unglaubliche, aber wahre Aussage.
Liebe Schwestern und Brüder, Jesus und die kanaanäische Frau bezeugen, dass Glaube immer mit Wachsen und Entwicklung zu tun haben – auf beiden Seiten. Glauben ereignet sich im Leben, insbesondere in Krisen, und entwickelt und verändert sich. Er ist nicht abstrakt, sondern arbeitet sich ab an den alltäglichen Herausforderungen und Leiden. Offenbar ist es manches Mal gut, wenn einem eine Fremde plötzlich vor die Füße fällt. Vielleicht ist es heilsam, wenn Fremde plötzlich vor der eigenen Haustüre auftauchen. Bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, nicht selten weitet so etwas den Blick, wenn ich mich darauf einlasse und diese Begegnung mir zu Herzen geht.
Mit Menschen, wie der kananäischen Frau, beginnt die Gemeinde Jesu Christi als Gemeinschaft der Glaubenden, in der Herkunft und Geschlecht keine Rolle mehr spielen. In diesen Prozess des Gebens und Nehmens sind wir einbezogen – im spannungsvollen Hören auf das Wort des lernenden Lehrers. Ob wir es zulassen können und uns darauf einlassen?
---
Pater Jonas und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegnete Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Verdunstung und Erfahrung
13. August 2023
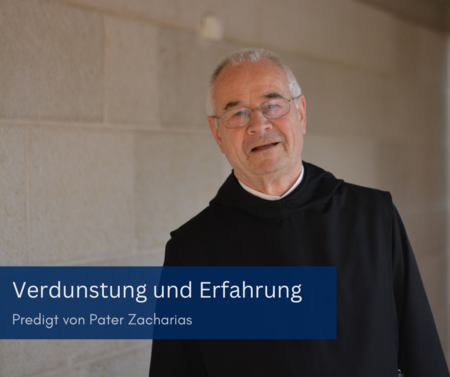 Was den Jüngern und Petrus in dem Evangelium, das wir heute lesen und hören, widerfährt, geschieht es nicht auch immer wieder in der Geschichte der Kirche? Geschieht es nicht auch in unserem eigenen Leben? - Jesus scheint abwesend zu sein: Er hat seine Jünger allein im Boot auf den See hinausgeschickt, er zieht sich zurück, allein auf den Berg, um zu beten. Und die Jünger sind allein auf dem See, dem Gegenwind und den Wellen ausgeliefert! Ohne ihn geschieht ‚Verdunstung‘ des Glaubens; wenn der Blick nicht auf ihn gerichtet ist, geht das Vertrauen verloren.
Was den Jüngern und Petrus in dem Evangelium, das wir heute lesen und hören, widerfährt, geschieht es nicht auch immer wieder in der Geschichte der Kirche? Geschieht es nicht auch in unserem eigenen Leben? - Jesus scheint abwesend zu sein: Er hat seine Jünger allein im Boot auf den See hinausgeschickt, er zieht sich zurück, allein auf den Berg, um zu beten. Und die Jünger sind allein auf dem See, dem Gegenwind und den Wellen ausgeliefert! Ohne ihn geschieht ‚Verdunstung‘ des Glaubens; wenn der Blick nicht auf ihn gerichtet ist, geht das Vertrauen verloren.
Aber Jesus ist da! Mitten in den Wellen auf dem See ist er für die Jünger da. Doch sie sind blind vor Angst! ‚Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht!‘, ruft er ihnen und uns zu – und Petrus fasst Mut: ‚Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich über das Wasser zu dir komme!‘ ‚Komm!‘, sagt Jesus. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu, über das Wasser. Doch der Wind und die Wellen sind noch da, er erschrickt und das Erschrecken reißt ihn in die Tiefe, aus der er ruft: ‚Herr, rette mich!‘
Gehört diese Erfahrung nicht auch zu unserem persönlichen Glauben: ein besonderer Gottesdienst, ein Wort im Sonntagsevangelium, ein Satz aus einer Predigt oder eine Begegnung mit einem überzeugten Christen bewirkt plötzlich eine große Zuversicht in uns, wir werden mutig und singen vielleicht vor Freude: ‚Meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht!‘ – Aber dann kommt der Alltag wieder und mit ihm melden sich die alten Probleme und Widerstände zu Wort und darauf gebannt, rutsche wir wieder in die alten Lebensmuster und wir fallen noch tiefer.
Wäre Petrus im Boot geblieben, wäre ihm die Erfahrung des Untergehens erspart geblieben. Aber er hätte auch eine entscheidende Erfahrung nicht gemacht: Ich muss Jesus im Auge behalten und nicht gebannt auf die Wellen und den Gegenwind schauen. Nur mit Jesus im Blick werde ich die Risiken des Lebens und des Glaubens bestehen.
Wenn ich mich ganz auf Jesus konzentriere, wenn ich ihn im Auf- und Ab- meines Lebens im Blick behalte, kann ich die Erfahrung machen: Jesus, der Auferstandene, vermag mich aus dem Strudel meiner Ängste herauszuholen – Jesus lässt mich nicht fallen!
---
Pater Zacharias und alle Brüder in Tabgha und Jerusalem wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Verklärung und Kreuz
6. August 2023
 Der Berg Tabor, auf den wir mit dem heutigen Festgeheimnis hinaufsteigen ragt aus der Jesreel-Ebene in Galiläa in bestechender Form heraus. Er sieht bisschen aus wie eine Parabel-Kurve, erwachsen wie aus einer mathematischen Formel auf einem Koordinatenkreuz.
Der Berg Tabor, auf den wir mit dem heutigen Festgeheimnis hinaufsteigen ragt aus der Jesreel-Ebene in Galiläa in bestechender Form heraus. Er sieht bisschen aus wie eine Parabel-Kurve, erwachsen wie aus einer mathematischen Formel auf einem Koordinatenkreuz.
Dort auf dem Berg Tabor, bei der Verklärung erklingt eine klare Ansage Gottes: Mein geliebter Sohn! Hört auf IHN! – Einfach. Fokussiert. Eine Art von Kurzkatechse für jeden, der fragt, wie das geht mit dem Glauben und einem Leben im Angesicht Gottes: Jesus. – Auf IHN schauen. Auf IHN hören. In Seinen Spuren gehen, IHM nachgehen, von Seinem Beispiel lernen.
Das klingt so banal und einfach, wie es herausfordernd ist. – Nachfolge Jesu ist nicht einfach und klar: Auch wenn wir es wollen und uns darum bemühen, scheitern wir doch oft genug an unseren Schwächen und Grenzen. Und auch unser Umfeld macht es uns nicht immer leicht.
Ein sprechendes Bild für diese Spannung ist das Kreuz. Bis heute ist es, wie schon Paulus formuliert, „für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit“ (1Kor 1,23). Das hat auch im Jahr 2023 immer noch historische Gründe, weil im Namen und im Zeichen des Kreuzes auch unfassbares Leid und Unglück über Menschen gebracht wurde. Das ist ein Erbe, das wir als Kirche nicht leugnen können, das uns herausfordert, und das eine Sensitivität und Wachsamkeit erfordert.
Gleichzeitig aber ist es für uns als Christen das Zeichen des Heils schlechthin. – Im Wissen um all das Schlechte und Gescheiterte, das Verwundete und Zerbrochene in uns und um uns ist das Kreuz das Zeichen dafür, dass es eben nicht beim Schlechten und Gescheiterten, bei den Verwundungen und Brüchen in uns und um uns bleibt, sondern dass Gott in Seiner Liebe und Barmherzigkeit all das barmherzig anschaut und vorsichtig in Seine Hand nimmt, dass ER es hält und heilt.
Man kann das Tabor-Ereignis, die Verklärung Jesu ja auch durchaus als eine Art nachösterlicher Erzählung verstehen: Die drei Jünger verlassen auf ausdrückliche Einladung Jesu für eine Zeit die Ebene des Alltags, steigen auf den Berg mit IHM. All die Sorgen und Fragen, die werden dann in diesem wunderbaren und unerschaffenen Tabor-Licht eingefangen. Das Gesetz der Alten, in der Gestalt des Moses, und die Prophezeiungen des Heils, in Gestalt des Elija, werden eins mit der neuen und befreienden Botschaft des Evangeliums in Jesus, dem Verklärten. Dem geliebten Sohn. Schaut hin. Hört auf IHN! ER trägt unsere Wunden und sie sind angenommen, verklärt.
Wir feiern an diesem Morgen und durchaus bewusst die erste Eucharistie unter unserem neuen Kreuz hier in der Dormitio-Basilika. – Ein Novum. Soweit ich es aus den wenigen Fotos der Vergangenheit erkennen kann, gab es noch nie ein Hängekreuz im Altarraum unserer Kirche. Kreuze, die auf dem Altar standen oder daneben, die gab es immer. Nun haben wir über dem Altarraum und der ganzen Kirche ein Kreuz, fast schwebend. Das mag für manche unserer Besucher und Gäste, die ja nicht nur aus dem christlichen Umfeld kommen, ein Ärgernis sein. Das müssen wir ernst nehmen. Und es ist für unsere Klosterfamilie eine Herausforderung, dass wir mit unserem Leben hier auf dem Zion, mit unseren verschiedenen Diensten und Aktivitäten im Kloster und darüber hinaus immer wieder auch ein Zeugnis dafür geben, dass das Kreuz dafürsteht, dass wir alle angenommene Kinder Gottes sind. Dass es eine Hoffnung für alle gibt. Dass für uns als Christen das Kreuz nicht eine Waffe ist, sondern mehr ein Brückenpfeiler, der verbinden will: Uns Menschen mit Gott. Uns Menschen untereinander. Mich Menschen mit mir selbst. – Wenn man unser Kreuz von unten anschaut, kann man eine solche Brückenpfeiler-Funktion durchaus erahnen.
Ein Kreuz auf dem Zion, ein Kreuz im Heiligen Land. – Dieses Kreuz verankert nun gleichzeitig auch unsere Mönchsfamilie mehr im Heiligen Land. Wir haben bewusst Olivenholz als Material gewählt. Auch wenn es nicht das typische Bauholz im Heiligen Land ist, ist der Olivenbaum doch ein sehr sprechender Baum in diesem Land: die zur Noahs Arche zurückkehrende Taube; die uralten Bäume überall hier im Land, nicht zuletzt im Garten Getsemani; die große Bedeutung und vielfache Nutzung der Olivenfrüchte und des Olivenöls; die politische und emotionale Brisanz, wenn Olivenhaine ausgerissen oder abgebrannt werden. – Der Olivenbaum ist ein Kind dieses Landes.
Kinder dieses Landes sind auch eng an der Entstehung unseres Kreuzes beteiligt, womit Glaubensgeschichten zu erzählen sind: Das Holz für unser Kreuz stammt aus Tabgha. Vor etlichen Jahren hatte man uns für dort ältere Olivenbäume gestiftet, die in Tabgha leider nicht angingen. Das Kreuz-Projekt war nun eine Chance, diese Bäume dennoch zu würdigen. Ich habe unseren Tabgha-Baumann Khalil Dowery aus Nazareth um Hilfe gebeten, die Bäume zu sichten und zu schneiden. Im Laufe der folgenden Gespräche hat Familie Dowery dann entschieden, die komplette Herstellung des Kreuzes selbst in die Hand zu nehmen und zu finanzieren. Damit hat Khalil, der in Tabgha so ziemlich alles gebaut und renoviert hat, nicht nur zu Beginn seiner beruflichen Karriere das vergoldete Metallkreuz auf dem kleinen Dachtürmchen der damals neuen Brotvermehrungskirche gestiftet, sondern jetzt, beim Eintritt in den Ruhestand, auch dieses neue Kreuz im Altarraum der Dormitio. Überdies: Jene Familie, die seinerzeit die Bäume nach Tabgha gestiftet hatte, ist eng mit dem Schreiner verwandt, der unser Kreuz gefertigt hat. – Bauleute aus Nazareth, ein Kreuz aus galiläischem Olivenholz, in unserer Mitte.
Entworfen hat das Kreuz unser Projektarchitekt Martin Struck. Er greift dabei in allen drei Dimensionen die Maße der Mensa des Altares auf. Länge, Breite und Tiefe der großen Steinplatte auf dem Altar spiegeln sich fast auf den Millimeter genau im Olivenholzkreuz. Das Kreuz an sich ist einfach und klar. Keine zusätzliche Ornamentik, auch kein Corpus. Nur das Kreuz, die sich durchstoßenden Achsen horizontaler und vertikaler Bewegung, Himmel und Erde. Die Seiten sind leicht geschwungen. Sie beschreiben eine mathematisch-geometrische Parabel in ihrem Beginn. – Unsere Glaubens- und Lebensgeschichten prägen sich im Kreuz unseres Herrn ab, drücken sich gewissermaßen aus den Ebenen unseres Alltags in die Ebene des Kreuzes hinein. Wie der Tabor sich aus dem Heiligen Land in den Himmel und in das Licht Gottes erhebt.
Mit der Eucharistiefeier an diesem besonderen Festtag der Verklärung des Herrn stehen wir jetzt bewusst unter diesem Olivenholzkreuz und gleichzeitig auf dem Tabor. Unser Kreuz wird über Tag vom Licht der Jerusalemer Sonne durch unsere Onyx-Fenster gestreift: Ein Bild unserer Sehnsucht nach Heil und Heilung, nach Gottes Nähe. Der Berg der Verklärung erstrahlt im unerschaffenen Tabor-Licht: Gottes Liebe und Nähe umfasst den Sohn, die Patriarchen und Propheten, die Apostel und alle anderen, die auf Jesus schauen und auf IHN hören. ER ist mitten unter uns. Im Zeichen des Kreuzes. In Seinem Wort. Im Brotbrechen. In unserem Bruder und unserer Schwester. „Wie ein Licht,das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in [unserem] Herzen“ (vgl. 2Petr 1,19).
---
Pater Basilius und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Die entscheidende Bitte
30. Juli 2023
 Hand aufs Herz: Was würdest Du Dir für Dein Leben wünschen, wenn Gott zu Dir heute wie zu König Salomo sagen würde: „Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll!“?
Hand aufs Herz: Was würdest Du Dir für Dein Leben wünschen, wenn Gott zu Dir heute wie zu König Salomo sagen würde: „Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll!“?
“Hauptsache gesund: Das ist das Wichtigste! Gesundheit und ein langes Leben!” – “Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts!” – “Ich wünsche diesem arroganten Pinsel, dass er mal richtig auf die Nase fällt!”
Sätze, die ich in diesen Tagen hier und da immer wieder aufschnappe und mir selbst auch schonmal über die Lippen gekommen sind. Wünsche übrigens, die mindestens knapp 3000 Jahre auf dem Buckel haben und wohl zum Urgestein menschlichen Wünschens gehören – Wünsche, die in der heutigen Ersten Lesung überhaupt nicht gut wegkommen!
Diese Wünsche wirken auch alle ziemlich tragisch eng und klein angesichts der Sterblichkeit von uns Menschen: Die beste Gesundheit und das längste Leben kommen im Tod abrupt zum Ende, genauso wie auch aller materieller Besitz in einem Mal verpufft und im Tod wertlos wird – dasselbe gilt exakt auch für meine Mitmenschen, ob ich sie mag oder nicht.
Wie anders ist da der Wunsch Salomos nach einem hörenden Herzen, nach einem besseren Verstehen- und Unterscheiden-Können, nach einer größeren Sensibilität und wacheren Aufmerksamkeit für Recht und Gerechtigkeit und für die Freude, Hoffnung, Trauer und Angst der Mitmenschen! Diese Gott- und Menschensuche, die zu einem Mehr an Liebe führt, endet nämlich nicht im Tod, sondern findet Ihre Vollendung im ewigen Leben bei Gott, auf das wir hoffen dürfen. Die Liebe ist nämlich stärker als der Tod!
Also, Hand aufs Herz: Was würdest Du Dir für Dein Leben wünschen, wenn Gott Dich heute wie König Salomo fragen würde?
---
Abt Nikodemus und alle Brüder in Jerusalem und in Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Unrentable Landwirtschaft
16. Juli 2023
 Das heutige Evangelium ist mir von Kindesbeinen an vertraut. Aber schon damals habe ich mich gewundert: Hat Jesus denn keine Ahnung von Ackerbau?
Das heutige Evangelium ist mir von Kindesbeinen an vertraut. Aber schon damals habe ich mich gewundert: Hat Jesus denn keine Ahnung von Ackerbau?
In dem Gleichnis steht, dass ein Teil der Körner auf den Weg fällt und von den Vögeln gefressen wird. Ein zweiter Teil fällt auf den felsigen Grund, kann nicht wurzeln und verdorrt, sobald es heiß wird. Ein dritter Teil fällt unter die Disteln und erstickt. Nur der vierte Teil fällt auf guten Boden und bringt gute Frucht. Nur ein Viertel gelingt! – Das ist doch unrentabel! So zu wirtschaften ist doch verrückt!
Bei uns im Dorf gab es mehrere Bauern und auch unsere Familie bewirtschaftete als Nebenerwerb einige Felder. Obwohl ich noch ein Kind war, wusste ich damals schon, dass man vor dem Säen den Acker zuerst bereiten muss. Man muss ihn von Steinen und Disteln reinigen, ihn pflügen und dann Furchen ziehen. Erst danach kam die Aussaat. Zuerst streut man vorsichtig am Rand, der an die ausgetretenen Pfade angrenzt, einige Körner aus – ganz vorsichtig, damit nichts verlorengeht. Danach erst wirft man die restliche Saat großzügig in der Mitte aus.
Ich kann mich noch gut an die Plastikschale zum Umhängen erinnern, mit der meine Eltern sowohl die Körner als auch den Dünger auswarfen. Danach wurde der Acker nochmals gepflügt, damit die Körner wirklich in den Ackerboden kamen; sonst hätten die Vögel sie ja direkt weggepickt. Nur so konnten die Weizenkörner wachsen und nur so konnte man später ernten. So arbeiteten wir damals auf dem Feld – und nicht so unvernünftig wie im heutigen Evangelium, im Gleichnis Jesu.
In meinem Theologie-Studium lernte ich dann später, in einer Vorlesung, dass jedes Gleichnis eine Bildseite und eine Auslegungsseite hat. Das Bild stamme meistens von Jesus und die Auslegung im Evangelium sei eine spätere Hinzufügung der frühen Christengemeinden – und die Auslegung sei: Dem Bild vom Säen und den verschiedenen Böden entspricht das Wort Gottes und die verschiedene Aufnahmebereitschaft der Zuhörer und Menschen. Und ich lernte auch, dass man diese Auslegung „objektiv“ nennt, da die verschiedenen Böden verschiedenen Menschen entsprechen. Mir fiel dann damals im Studium zu jedem Boden einige Personen aus meinem Bekanntenkreis und der Pfarrgemeinde ein: manche bei denen das Wort Gottes wie an einer Wand abprallte; manche bei denen es ankam, aber nur oberflächlich und dann bei Gegenwind verschwand; bei manchen fasste das Wort schon etwas Fuß und Festigkeit, dann aber kamen die Sorgen des Alltags und auch die kleinen Lüftchen des Tages und der Nacht und der gute Beginn wurde abgewürgt. Und ich rechnete mich natürlich zu den Menschen, die wie ein fruchtbarer Boden sind. Doch ich lernte auch, dass es noch eine zweite, eine sogenannte „subjektive“ Auslegung gibt. Alle diese unterschiedlichen Böden, bzw. Aufnahmeweisen gibt es auch in mir, in mir als Subjekt! Manchmal geht das Wort Jesu in ein Ohr hinein und aus dem anderen hinaus, manchmal ist man gerührt und betroffen, aber bald darauf ist alles vergessen, manchmal kann das Wort keine Wurzeln schlagen, weil ich mit anderem beschäftigt bin und nur manchmal bin ich aufmerksam und höre und es fruchtet…. Ja diese verschiedenen Haltungen sind auch meine Reaktionen auf die Worte Jesu und oft schäme ich mich deswegen, weil ich doch nur der gute Boden mit viel Frucht sein will.
Diese Unterscheidungen zwischen Bild und Auslegung, zwischen objektiver und subjektiver Auslegung lösten aber nicht mein Problem des scheinbar unrentablen und unvernünftigen Säens: Einfach so das Saatgut durch die Gegend zu werfen, ohne den Boden bereitet zu haben, ohne den Acker gereinigt zu haben, ohne zu achten, wohin die Körner fallen – das blieb doch unvernünftig und unrentabel. Und dann hat mir vor ein paar Jahren die Auslegung des Gleichnisses durch den Karmeliten Reinhard Körner die Augen und Ohren geöffnet. – „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“
In diesem Gleichnis des Matthäusevangeliums – dem ersten nach der gewaltigen Bergpredigt, der Jüngerunterweisung und -aussendung und nach den vielen unglaublichen Heilungen – erzählt Jesus von sich selbst! All seine Worte und Taten sind nicht nur auf offene Ohren gestoßen, sondern auch auf heftige Ablehnung. Jesus befindet sich einer brenzligen Lage. Wie wird es weitergehen für ihn? Der Bauer, dieser Sämann ist Jesus selbst. In den Augen der vielen sind er und sein Tun verrückt, unvernünftig und lachhaft. Was er zu sagen hat, sät er aus, gelegen oder ungelegen, so schwungvoll wie er nur kann und er wendet sich jedem zu. Er kümmert sich nicht ängstlich darum, ob und wie die Saat aufgehen wird. Er pflügt nicht zuerst die Herzen seiner Zuhörer und reißt auch nicht die Disteln und Dornen aus deren Köpfen aus. Er schaut nicht, wo die Grenze des Ackers ist und wo der festgetretene Trampelpfad beginnt. Er prüft nicht, ob die Hörer genug Tiefe haben. Er spricht und sät – die Zeit, zu sagen was er zu sagen hat, ist da. Und er weiß: Was er aussät, wird reiche Frucht bringen, denn das, was er aussät, ist die Wahrheit.
Diese Auslegung hat mich nachdenklich gemacht und berührt! Und ich habe sie wieder gespürt: den Acker in meinem Herzen, die Disteln und Dornen in meinem Kopf, die eingefahrenen und ausgetretenen Trampelpfade in meinem Tun. Gottes Barmherzigkeit ist überreich. Gottes Güte ist unvernünftig. Gott bedenkt nicht, ob etwas rentabel oder vernünftig ist. Er handelt voll Erbarmen – an all seinen Geschöpfen. Ich bewundere diese Hoffnung, diese Zuversicht im Säen Gottes! Und ich bin mir sicher: Was Gott aussät, wird Frucht bringen – reiche Frucht, überreich, auch wenn es auf den ersten Blick unglaublich und unvernünftig erscheint!
---
Pater Elias und alle Brüder in Jerusalem und in Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Freue Dich!
9. Juli 2023
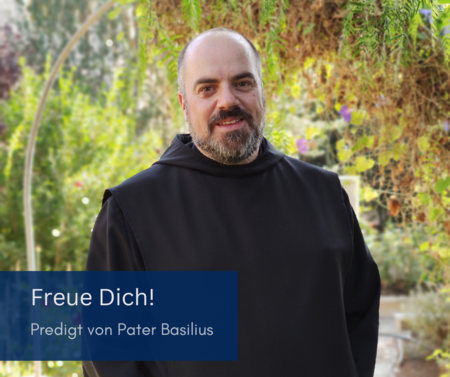 Es weht ein bisschen Advent und Weihnachten durch diesen Sonntag: Der Prophet Sacharja singt mit uns: „Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir!“
Es weht ein bisschen Advent und Weihnachten durch diesen Sonntag: Der Prophet Sacharja singt mit uns: „Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir!“
„Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem…“ – Und das Echo klingt bis in den Palmsonntag: Dein König, „demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin“.
Das könnte jetzt, mitten im Sommer und in der Urlaubszeit, kitschig werden, deplatziert sein. – Aber die Worte des Propheten treffen in unsere Zeit mitten hinein: Der kommende „König wird den Nationen Frieden verkünden“, Streitwagen und Kriegsbogen werden ausgemerzt. Was für eine große Vision! Wie viele Menschen dieser Tage möchten dieses Lied mitsingen, möchten in dieser Hoffnung in die neue Woche, in eine neue Zeit gehen! Hier im Heiligen Land, in dem sich die Gewaltspirale zwischen Israelis und Palästinensern immer weiterdreht und -windet, in dem selbst die innerisraelischen Konfliktlinien mit immer mehr Gewalt markiert werden. Vom Krieg in der Ukraine und den Kreisen um ihn herum ganz zu schweigen.
Aber wir dürfen Sacharja auch direkt in unser Leben hineinrufen lassen: Sacharja, seine Visionen, seine Botschaft sind getragen von der Zuversicht auf das kommende Heil. Juble! Jauchze! Der König kommt zu dir! Zu Dir! – Man kann darin eine der möglichen Verdichtungen des biblischen Gottesglaubens sehen: Gott will unser Heil, und ER sieht auf jeden einzelnen Menschen, kennt ihn oder sie mit Namen. Zu Dir! Dein König! ER kennt Dein Leben mit allen Problemen und Brüchen, ER weiß um das Böse, was Du getan hast, ebenso wie um das Böse, das andere Dir zufügen. Dieser König ist keine Vertröstung, kein „Opium für das Volk“. ER kommt zu uns, ist der Immanuel. In der Krippe von Bethlehem und im brennenden Dornbusch, beim Einzug in die Heilige Stadt Jerusalem und beim Durchzug durch das Rote Meer, im Olivenzweig nach der Sintflut und im Holz des Kreuzes auf Golgotha, am Morgen der Schöpfung und in der aufgehenden Sonne des Ostermorgens.
2000 plus X Jahre Theologie und Tradition, aktuelle Diskussionen um den Kurs des Kirchenschiffes, Strukturdebatten und Vertrauenskrisen lassen das vielleicht nicht immer erkennen. – Jesus aber weiß, wie sehr der „Vater, Herr des Himmels und der Erde“ die Menschen liebt, wie sehr ER das Heil der Menschen will. „Vor den Weisen und Klugen“ scheint das manchmal „verborgen“ zu bleiben, aber den „Unmündigen [wird es] offenbart“. Es geht in der Geschichten Gottes mit Seinem Volk, mit jedem Einzelnen, um die Mühseligen und die Beladenen, es geht um Erleichterung und Hilfe, um Heil, um Frieden und Gerechtigkeit, um Ruhe für die Seele. – Das muss vielleicht gar nicht viel weiter ausgeführt werden.
Nehmen wir die klaren Worte Jesu und des Propheten Sacharja einfach mit in die neue Woche, als Erinnerung und Zuspruch: Freue Dich! Ich komme zu Dir! Bei mir findest Du Ruhe für Deine Seele.
---
Pater Basilius und alle Brüder in Jerusalem und Tabgha wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
Kein billiges Danke
2. Juli 2023
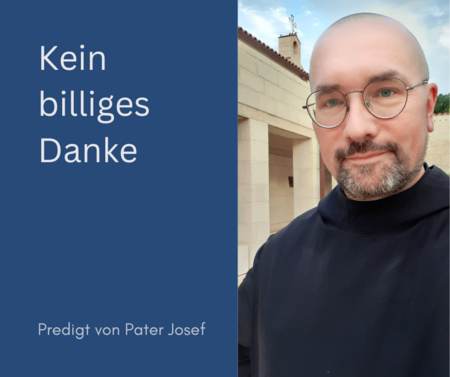 Was tat eigentlich ein Mensch, der sich vor zweitausend Jahren von Göttern und Idolen abwandte und in die christliche Gemeinschaft eintrat? Er vollzog einen radikalen Bruch mit seiner Umgebung. Er ließ sich mit ihr auf eine Auseinandersetzung ein, nicht selten auf Leben und Tod. Denn ein Eintritt in die christliche Gemeinschaft bedeutete nicht, eine Meinung neben vielen anderen möglichen zu haben; sondern es war eine Lebensentscheidung, eine Lebenswende - und zwar in dem Sinn, dass dieser Mensch sich zum Glauben an den einen Gott bekannte und zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Erlöser; und dass er sich abwandte von dem, was bislang Lebenssinn und Lebensinhalt war.
Was tat eigentlich ein Mensch, der sich vor zweitausend Jahren von Göttern und Idolen abwandte und in die christliche Gemeinschaft eintrat? Er vollzog einen radikalen Bruch mit seiner Umgebung. Er ließ sich mit ihr auf eine Auseinandersetzung ein, nicht selten auf Leben und Tod. Denn ein Eintritt in die christliche Gemeinschaft bedeutete nicht, eine Meinung neben vielen anderen möglichen zu haben; sondern es war eine Lebensentscheidung, eine Lebenswende - und zwar in dem Sinn, dass dieser Mensch sich zum Glauben an den einen Gott bekannte und zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Erlöser; und dass er sich abwandte von dem, was bislang Lebenssinn und Lebensinhalt war.
Sind wir uns bewusst, dass damit auch eine Gesetzmäßigkeit unseres eigenen Lebens als Christin und Christ angesprochen wird? Sind wir uns der Wende der Existenz bewusst, die mit unserem Glauben verbunden ist? Glauben bedeutet nicht bloß die Aufzählung von Lehren und Richtigkeiten, nicht bloß ein Annehmen von Theorien über Dinge, über die man an sich nichts weiß. Glaube im christlichen Sinn meint das Ja zu Jesus als Christus, als Erlöser, als Heil. Unsere Erlösung ist am Kreuz geschehen und sichtbar geworden. Christlicher Glaube bedeutet also, dass wir Ja sagen zu der Tatsache, dass einer für uns gekreuzigt worden ist; dass wir mit unserem ganzen Dasein dafür danken, dass wir alles diesem Jesus verdanken, „der uns geliebt und sich für uns dahingegeben hat“. Das ist das Erschütternde am Christentum: Man kann auf keine billigere Weise "Dankeschön" sagen als mit der ganzen Existenz; oder anders gesagt: Uns wird abverlangt, der Liebe, durch die wir erlöst worden sind, zuzustimmen; uns wird abverlangt, diese gekreuzigte Liebe als das Maß unseres Lebens anzusehen. Alle Quellen unseres Lebens entspringen dem Kreuzestod Jesu; denn alles, was wir sind (und dazu bekennen wir uns als Christen), sind wir nicht kraft eigener Leistung, sondern durch den erlösenden Tod Jesu. Sind wir uns dieser Grundgegebenheit bewusst?
Gaube bedeutet also immer wieder das bewusste Annehmen, das Empfangen der gekreuzigten Liebe Gottes, die uns erlöst hat! – Was ist meine Antwort auf den Anspruch Gottes in Jesus Christus? Meine Antwort verändert mein ganzes Leben. Das äußere Zeichen, der leibhafte Ausdruck dieser Antwort und der damit verbundenen Lebenswende hin zu Jesus Christus geschieht in der Taufe. Die Taufe ist das Zeichen des Angebotes Jesu und unserer Antwort. Paulus weist in der heutigen Lesung aus dem Römerbrief auf diesen entscheidenden Zusammenhang zwischen dem Kreuzestod Jesu und der Taufe hin: „Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod hin getauft sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.“ Taufe bedeutet also unser Bekenntnis zu unserer Erlösung durch den Kreuzestod Jesu Christi; Taufe bedeutet die Annahme und das Empfangen der von Jesus Christus bewirkten Erlösung.
Das Geschehen der Taufe weist uns hin auf den Zusammenhang unseres Christseins mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wieder ist es Paulus, der uns diese Grundgegebenheit ins Bewusstsein ruft: „Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft worden... Ihr sollt euch darum als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.“
Für diese Gewissheit, besser: für dieses Geschenk unserer Berufung wollen wir immer wieder Dank sagen; nicht zuletzt, wenn wir Eucharistie feiern dürfen!
---
Pater Josef und alle Brüder in Tabgha und Jerusalem wünschen Euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Über
Alle Blogbeiträge von
 Paul
Paul
Paul Nordhausen-Besalel ist schon etwas in der Welt herumgekommen, bis er nach seinem Pädagogikstudium in Israel landete. Aber er hat sich die Begeisterung eines Kindes bewahrt, wenn er seiner Arbeit und den Menschen, denen er dabei begegnet, entgegentritt. Als Leiter der Begegnungsstätte Beit Noah muss er das auch. – Von einem der schönsten Jobs rund um den See Genezareth berichtet er im Beit Noah-Blog.
 Nina.
Nina.
Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. (Psalm 122,2)
Acht Monate in Jerusalem leben und lernen: Dieser Traum wurde für Nina aus dem Schwabenland wahr.
Sie stammt aus einer württembergischen Kleinstadt bei Esslingen am Neckar. Auch für das Studium der Theologie verschlug es sie an den Neckar, diesmal direkt ans Ufer, nämlich nach Tübingen. Nach vier Semestern dort ist sie nun in Jerusalem, der Heiligen Stadt für Juden, Christen und Muslime.
In dieser Stadt, in der es nichts gibt, was es nicht gibt, macht sie jeden Tag aufs Neue faszinierende wie irritierende Erfahrungen, von denen sie im Studiblog berichtet.
Von pinkfarbenem Blumenkohl, eingelegten Oliven in Plastikeimern, Rolexverkäufern und sonstigen Erlebnissen und Begegnungen im Heiligen Land erzählt sie humorvoll auf ihrem privaten Blog „Nina im Heiligen Land” .
 Lukas (STJ 2012/13)
Lukas (STJ 2012/13)
Lukas Wiesenhütter liebt Humus, Falafel und den Gang durch die Gassen der Jerusalemer Altstadt. Nach sechs Semestern in Freiburg im Breisgau studiert er während der kommenden Monate Theologie an der Dormitio-Abtei. Nebenbei schreibt der 23-Jährige am Blog des Studienjahres mit.
 Caroline
Caroline
Caroline ist eine der vier DVHL-Volos, die 2013/14 in Tabgha ihren Dienst machen. Von ihrer Arbeit und ihrem Leben am See berichtet sie in diesem Blog.
 Florence Berg.
Florence Berg.
Florence was raised in Luxembourg, but returned to her native country Germany to take up theological studies in the lovely town of Tübingen, where she soon added a degree in Near Eastern Archeology, simply out of curiosity.
Although in Jerusalem and the entire Holy Land it's very hard NOT to stumble across some archeological remains (and so much more not yet discovered!), she'll also have a close look at living humans.
Greek-catholic nuns and French Dominican friars, Muslims and religious Jews, Christian Palestinians and German fellow students - it's quite unique, so enjoy Florence's reports, impressions and anecdotes!
 Bruder Franziskus
Bruder Franziskus
Wer Bruder Franziskus einmal in Tabgha erlebt hat, der hat den Eindruck, dass er schon immer da ist: Die Verbundenheit mit diesem sehr besonderen Teil der Schöpfung, die Offenheit für die Menschen und besonders die Nähe zu Jesus, der diesen schönen Ort am See mit den Menschen geteilt hat, machen aus Bruder Franziskus einen echten Tabgha-Mönch.
Auch den Neubau und die Menschen um ihn herum hat er im Blick. Im Bautagebuch erzählt er davon.
 Tony
Tony
Tony (Anthony) Nelson ist von Hause aus Philosoph, d.h. von seinem ersten Studienabschluss her. Den hat er an der St. John's University in Collegeville (Minnesota/USA) gemacht. Das ist bestimmt nicht die schlechteste Voraussetzung für den zweitschönsten Job am See Genezareth: Assistent des Leiters der Begegnungsstätte Beit Noah. Tony, der im Rahmen des Benedictine Volunteer Corps bei uns in Tabgha ist, erzählt von seiner Arbeit im Beit Noah-Blog.
 Annika (STJ (2012/13)
Annika (STJ (2012/13)
Annika Schmitz hat ihr Theologiestudium vor sieben Semestern als überzeugte Kölnerin in Freiburg im Breisgau begonnen. Sie hat also einige Erfahrung damit, sich auf fremde Kulturen einzulassen.
Bis Mitte April lebt, studiert und bloggt die 23-Jährige aus Jerusalem.
 p basilius
p basilius
„Willst du von der Welt was seh’n, musst du in ein Kloster geh’n!“ – Im Gemeinschaftsleben im Kloster mit den Brüdern, mit Gästen, Studierenden und Volontären kann man in der Tat viel von der Welt sehen und erfahren. Und mindestens die halbe Welt kommt nach Jerusalem und Tabgha, weil es sich einfach lohnt... – Aus diesen Welten im und ums Kloster erzählt Pater Basilius, der Prior unserer Teilgemeinschaft in Tabgha.

Mit einer Unterbrechung von etwa eineinhalb Jahren, in denen er im „Haus Jerusalem” lebte, ist Pater Jeremias schon seit über zehn Jahren in Tabgha.
Den Entstehungsprozess des neuen Klosters hat er intensiv miterlebt und geprägt: Bei der Erstellung des Masterplanes, einer Art Bebauungs- und Flächennutzungsplans, in unzähligen Gesprächen mit den Brüdern, den Architekten und den Vertretern des DVHL und in der Begegnung um im Kontakt mit Spendern, die dieses Projekt in so wunderbarer Weise ermöglichen.
 Peter Blattner
Peter Blattner
Peter Blattner gehört zur vierten Generation amerikanischer Volontäre, die uns die Benediktinerhochschule St. John's/Collegeville in Minnesota schickt. Wie auch seine Vorgänger verstärkt er das Beit Noah-Team um Leiter Paul Nordhausen Besalel.
Im Beit Noah-Blog berichtet er, was er auf der und um die Begegnungsstätte so alles erlebt!
 Nancy Rahn.
Nancy Rahn.
Nancy ist Weltenbummlerin und beobachtet gerne Menschen. Dafür ist sie in Jerusalem genau an der richtigen Adresse.
Ursprünglich studiert Nancy im kleinen Tübingen und genießt deshalb den Trubel und das Getümmel in den kleinen und großen Straßen ihrer neuen Heimat auf Zeit.
Von eindrücklichen Erfahrungen, witzigen und nachdenklichen Begegnungen und davon was es heißt, mit einem Haufen ganz unterschiedlicher Menschen zusammen ein dreiviertel Jahr lang das Land der Bibel kennenzulernen, berichtet sie im Studi-Blog.
Weitere Beobachtungen teilt Nancy auf ihrem privaten Blog Nancy auf dem Zion.
 Pater Ralph
Pater Ralph
Spötter behaupten, eine der wichtigsten Beschäftigungen der Benediktinermönche sei es zu bauen. – Das ist genauso böse wie richtig. Denn der Bau eines neuen Klosters in Tabgha ist für unsere Gemeinschaft dort ausgesprochen wichtig, um an diesem beliebten und belebten Pilgerort einen sicheren und geschützten Lebensraum als Mönche zu haben. – Pater Prior Ralphs Tagewerk richtet sich nach den Baumaschinen und Handwerkern, wovon er im „Bautagebuch“ berichtet.
 Tobias Weyler.
Tobias Weyler.
Tobias ist gebürtiger Düsseldorfer und Kölner Erzbistumskind. Deshalb lag es nahe, dass er sein Theologiestudium vor zwei Jahren in Bonn begann.
Jerusalem und Israel reizen ihn politisch, sprachlich, kulturell, wissenschaftlich und natürlich religiös. Über seine Erfahrungen und Eindrücke berichtet er hier zusammen mit Nina und Nancy.
Außerdem bloggt Tobias auch unter yerushalayimshelzahav.over-blog.de!
 Carolin.
Carolin.
Mein Name ist Carolin Willimsky. Ich bin dieses Jahr (2012/13) Volontärin in Tabgha, dabei werde möglichst regelmäßig diesen Blog schreiben.
 Abbot Gregory
Abbot Gregory
Born and grown up in Belfast Abbot Gregory made, of course, very specific experiences with people of different religions or denominations. It is not only a question of peace or violence, even more it is a process of learning together.
As an Irish monk of a German monastery in the holy city of Jerusalem Abbot Gregory will share his impressions of ever day’s life here in Jerusalem between all those people of various languages, cultures and religions – not always easy people, but interesting people.
 Unsere heutige erste Lesung aus dem Alten Testament klingt, als wäre sie von einem christlichen Autor geschrieben, und doch wurde sie etwa zwei Jahrhunderte vor Christi Geburt verfasst. Der jüdische Autor, den die Tradition Jesus Sirach nennt, dessen Name eigentlich aber Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira ist, provoziert uns mit genau demselben Maßstab für Vergebung, den auch Jesus uns im Vaterunser lehrt. Mit Jesus Christus zusammen beten wir zu unserem himmlischen Vater: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". Im Weisheitsbuch von Jesus Sirach lesen wir: „Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben!“; und er stellt eine unbequeme Frage: „Ein Wesen aus Fleisch verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben?"
Unsere heutige erste Lesung aus dem Alten Testament klingt, als wäre sie von einem christlichen Autor geschrieben, und doch wurde sie etwa zwei Jahrhunderte vor Christi Geburt verfasst. Der jüdische Autor, den die Tradition Jesus Sirach nennt, dessen Name eigentlich aber Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira ist, provoziert uns mit genau demselben Maßstab für Vergebung, den auch Jesus uns im Vaterunser lehrt. Mit Jesus Christus zusammen beten wir zu unserem himmlischen Vater: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern". Im Weisheitsbuch von Jesus Sirach lesen wir: „Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben!“; und er stellt eine unbequeme Frage: „Ein Wesen aus Fleisch verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben?"